Stadtluft macht Arbeit
Kommunaler Arbeitszwang als ein Baustein des Niedriglohnsektors
Bei unseren bisherigen Nachforschungen und Veranstaltungen zu neuen Modellen des kommunalen Arbeitszwangs haben wir festgestellt, daß insgesamt der Druck auf SozialhilfeempfängerInnen verstärkt wird. Dabei gibt es aber keine einheitliche Entwicklung, sondern es sind zwei Tendenzen erkennbar, die im Austausch von einzelnen kommunalen Projekten und bundesweiten Untersuchungen und Vorgaben herausgebildet werden: einerseits wird in einigen Städten der staatlich finanzierte zweite Arbeitsmarkt ausgeweitet, andererseits gibt es neue Modelle der trickreichen Vermittlung in die direkte Ausbeutung durch das Kapital. Beide Tendenzen können durchaus in derselben Kommune kombiniert werden.
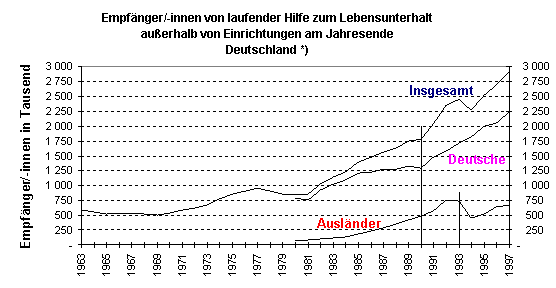
*) Bis einschließlich 1990: früheres Bundesgebiet; ab 1991: Deutschland.
Einführung des Asylbewerberleistungsgesetzes im November 1993.
Seit der Krise 1992/1993 ist die Anzahl der SozialhilfeempfängerInnen bundesweit und besonders in den Großstädten dramatisch angestiegen. Bezeichnend ist dabei, daß ihre Zahl jetzt schneller steigt als die Zahl der Arbeitslosen. (s. Schaubild) Krise und Arbeitslosigkeit drücken sich inzwischen also stärker als früher in der Sozialhilfe als in der registrierten Arbeitslosigkeit aus. Der Anteil der arbeitslosen SozialhilfeempfängerInnen ist ebenfalls gestiegen, und neben Arbeitslosengeld oder -hilfe wird immer häufiger ergänzende Sozialhilfe beantragt; dasselbe gilt auch für Beschäftigte mit Niedrigstlöhnen: beides ist Ausdruck gesunkener Löhne und gestiegener Mieten. Arbeit, Arbeitslosigkeit mit Bezahlung durch das Arbeitsamt oder Arbeitslosigkeit mit Bezahlung durch das Sozialamt gehen also immer mehr ineinander über.
Sozialstaat und Sozialverwaltung (Arbeitsämter, Sozialämter) reagieren darauf seit einigen Jahren verstärkt mit dem Versuch, Arbeitslose und SozialhilfeempfängerInnen gezielt und mit neuen Methoden in den untersten Bereich des ersten Arbeitsmarktes zu drücken. Auf gesetzlicher Ebene drückt sich dieser Versuch im Übergang vom alten Arbeitsförderungsrecht zum neuen Sozialgesetzbuch III aus, in dem es eindeutig heißt: »Vorrang hat die Integration in den ersten Arbeitsmarkt.«
Arbeiten à la SPD
Die neue rotgrüne Regierung ist mit dem Slogan »Arbeit, Arbeit, Arbeit« an die Macht gekommen und hat schnell weitreichende Veränderungen am Sozialstaat angekündigt: Lafontaine überlegte z.B. laut, ob nicht auch das ArbeitslosenGELD in Zukunft an eine tatsächliche Bedürftigkeit zu binden sei, eine Vorstellung, gegen die sich der Blüm-Flügel innerhalb von CDU und alter Regierung jahrelang erfolgreich gewehrt hatte. Ein Teil des »Bündnisses für Arbeit« (und »Wettbewerbsfähigkeit«, wie die Sozialdemokratie ehrlicherweise dem alten Titel hinzugefügt hat) sind neue Programme, um Arbeitslose zwangsweise in Jobs oder Maßnahmen zu drücken. Kurz nach Regierungsantritt wurde ein Sofortprogramm verkündet, das 100.000 Jugendliche in Arbeit oder Ausbildung bringen soll. Lohnkostenzuschüsse an die Unternehmer sind selbstverständlich enthalten. Dieser Plan wird offen als Drohung unter die Leute gebracht: »Falls ein Jugendlicher innerhalb des Programms ein zumutbares Angebot vom Arbeitsamt ablehne, müsse er mit Konsequenzen bei der weiteren Unterstützung rechnen, betonte (Bundesarbeitsminister) Riester. Die vorhandenen Gesetze erlaubten durchaus diesen Zwang.« (Süddeutsche Zeitung vom 16.1.99) Gerade den Jugendlichen soll also von Anfang an klargemacht werden, daß es kein Leben ohne Arbeit geben kann. Das ist die Linie aller sozialdemokratischen Regierungen, die in den letzten Jahren in Europa wieder an die Macht gekommen sind: ob Labour in England oder Sozialisten in Frankreich, ihre ersten Maßnahmen bestanden darin, Druck auf die arbeitslosen Jugendlichen auszuüben, einen Job anzunehmen. Niemand soll länger als ein halbes Jahr ungestört von Sozialleistungen leben können, das ist ihre Devise.
Die Sozialämter werden auf Trab gebracht
Seit einigen Jahren werden Sozialhilfeleistungen einer betriebswirtschaftlichen Durchleuchtung unterzogen. 1995 begann unter Leitung der Unternehmensberatungsfirma Kienbaum GmbH ein Projekt, das das »Sozialhilfegeschehen« in 15 Großstädten der BRD nach differenzierten Kriterien miteinander vergleichbar machen soll. Ziel ist es, jeweils von den Besten zu lernen und »Schlußfolgerungen für eine wirksame, wirtschaftliche und effizientere Sozialhilfe zu ziehen« (Sozialhilfe in Hamburg im Städtevergleich, 1995/96, Landessozialamt Hamburg). Im Durchschnitt ermittelte Kienbaum ein Kostensenkungspotential von fünf Prozent, im einzelnen sind durch die Vergleichsmöglichkeit mit mehreren anderen Städten sehr gezielte Sparmaßnahmen möglich: welche Stadt hat das »günstigste« Modell zur Möbelbeschaffung, welche die besten Tricks zur Pauschalierung des Kleidergelds auf breiter Basis, welche Stadt schafft es am effektivsten, arbeitsfähige SozialhilfeempfängerInnen wieder ans Arbeiten zu bringen?
In der letzten Frage versteckt sich das größte Problem, aber auch die größte Einsparmöglichkeit. Deshalb ist es nicht verwunderlich, wenn die Kommunen sich besonders um zwei Dinge bemühen: neue AntragstellerInnen vom Bezug der Sozialhilfe abzuschrecken (nach eigenen Angaben sind sie bei bis zu 25 Prozent erfolgreich) und arbeitsfähige SozialhilfeempfängerInnen den Kapitalisten als Billigarbeitskräfte in die Arme zu treiben.
In NRW-Städten sind, vom Landesarbeitsministerium gefördert, inzwischen sogenannte »Sozialbüros« eingerichtet worden, die die aus dem Kienbaumschen Kennzahlenvergleich gewonnenen Einsparungspotentiale auf kommunaler Ebene umsetzen sollen. Sozialämter und Arbeitsämter arbeiten in diesen Büros inzwischen munter zusammen. In Köln organisiert das entsprechende Sozialbüro sogenannte »Fallkonferenzen«, »um insbesondere bei Fällen, die hohe Kosten erzeugen, vorrangig Maßnahmen zur Hilfebeendigung einzuleiten«. (Zitat aus der »Rahmenkonzeption der Stadt Köln zur Haushaltskonsolidierung durch Verbesserung der Sozialhilfe«, 1996)
Abschreckung durch Arbeit
Neben seiner prinzipellen Fürsorgepflicht, niemanden verhungern oder erfrieren zu lassen, knüpft der Sozialstaat seine Leistungen immer an eine Grundbedingung: an die Arbeitswilligkeit. Rente ist die Durchhalteprämie für lebenslanges Schuften, und selbst die niedrigste Stufe von Unterstützung, die Sozialhilfe, ist von der Arbeitswilligkeit abhängig: »Wer sich weigert, zumutbare Arbeit zu leisten oder zumutbaren Maßnahmen nach den §§ 19 und 20 nachzukommen, hat keinen Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt« - so ist der Zwang zur Arbeit im Bundessozialhilfegesetz festgeschrieben (§ 25 BSHG).
Um die Drohung mit Arbeit auch in Zeiten von Massenarbeitslosigkeit wahrmachen zu können, ist schon in den 60er Jahren der sogenannte 'Zweite Arbeitsmarkt' geschaffen worden. Damit sind die besonderen Arbeitsplätze gemeint, die der Staat speziell für Arbeitslose einrichtet und finanziert (ABM, Hilfe zur Arbeit, etc.).
Für SozialhilfeempfängerInnen gibt es zwei Varianten dieser Arbeitsbeschaffung. Entweder sie bekommen weiter Sozialhilfe und für ihre Arbeit nur eine minimale 'Aufwandsentschädigung' (heute zwei bis drei Mark pro Stunde), oder sie werden für ein Jahr bei der Stadt oder bei Vereinen eingestellt, mit Lohn und Sozialversicherung. Das sind die 'Maßnahmen' im oben zitierten Paragrafen, die SozialhilfeempfängerInnen nicht ablehnen dürfen.
Das Hauptziel all dieser Maßnahmen ist die Abschreckung. Möglichst viele Leute sollen durch die Drohung mit Arbeit davon abgehalten werden, ihr Recht auf Sozialhilfe in Anspruch zu nehmen. Die Variante der Jahresverträge hat für das Sozialamt außerdem noch den Effekt, HilfeempfängerInnen zum Arbeitsamt zu verschieben, da nach der Maßnahme Anspruch auf Arbeitslosengeld besteht.
Seit dem Aufkommen der Massenarbeitslosigkeit in den 70er Jahren ist der Zweite Arbeitsmarkt enorm ausgeweitet worden. Besonders in Krisenzeiten versuchen die Kommunen, mit Arbeitsprogrammen die zunehmende Inanspruchnahme von Sozialhilfe einzudämmen. 'Hilfe zur Arbeit' funktioniert allerdings selten reibungslos. Gegen die Pflichtarbeit hat es immer wieder Proteste gegeben. Die Sozialämter mußten teilweise einen Rückzieher machen. Um die Arbeitspflicht tatsächlich durchsetzen zu können, mußten und müssen sie ihre Maßnahmen immer wieder verändern, differenzieren, ideologisch verkleistern oder für einzelne Gruppen akzeptabler machen. Der folgende kurze Rückblick bezieht sich auf Erfahrungen in Köln, die auf ähnliche Weise auch in vielen anderen Städten gemacht wurden.
Mitte der 70er Jahre hat das Kölner Sozialamt massenhaft SozialhilfeempfängerInnen zum Laubfegen geschickt, für 1,50 DM/Stunde. Auf den Friedhöfen traf sich eine bunte Mischung von Menschen, die aus sehr verschiedenen Situationen kamen. Hilfsarbeiter fegten neben Lehrern mit Berufsverbot, und alle hatten dieselbe Wut auf diese Arbeit. Sie gründeten die 'Interessengemeinschaft der Pflichtarbeiter e.V.', störten die Arbeit, protestierten und demonstrierten - und hatten Erfolg. An die 200 PflichtarbeiterInnen wurden 1976 von der Fegerei befreit.
In den folgenden Jahren wurden vor allem AsylbewerberInnen zur Zwangsarbeit verpflichtet, (und Gruppen, die es schon immer getroffen hat, wie Obdachlose und BerberInnen) - bis das Sozialamt in den 80ern einen neuen Versuch startete, die Arbeit für 1,50 DM auszuweiten. Dabei gingen sie schon ein bißchen gezielter und geschickter vor. Jetzt mußten nicht mehr alle auf den Friedhof. Leute mit Sozialberufen durften z.B. in Kindergärten aushelfen. Trotzdem war kaum jemand begeistert darüber, für 1,50 DM/Stunde zur Arbeit geschickt zu werden.
Als 1984 auch GenossInnen aus der Hausbesetzerbewegung vom Sozialamt zur Arbeit einberufen wurden, entstand die 'Initiative gegen Zwangsarbeit' (die zu dem Zeitpunkt übrigens nichts von ihrer Vorgängerin in den 70ern wußte). Damals gab es für ganz Köln noch eine zentrale Stelle für die 'Hilfe zur Arbeit'. Dort trafen sich entsprechend viele Zwangsverpflichtete, und die Flugblätter der Initiative stießen auf große Zustimmung. Für die Sachbearbeiter in diesem Büro wurde die Stimmung manchmal ziemlich ungemütlich. Oft ließen sie Sozialhilfeempfänger, die protestierten oder zusammen mit jemandem von der Initiative ankamen, lieber mit ihren Arbeitsangeboten in Ruhe.
Die Initiative organisierte auch Protestaktionen auf Arbeitsstellen. Eine Demonstration auf dem bekanntesten Kölner Friedhof fand in der Lokalpresse großes Echo. Viele SozialhilfeempfängerInnen wehrten sich auch einzeln: mit krankfeiern, zuspätkommen, oder schlecht arbeiten, bis hin zur Sabotage.
Auf all diesen Widerstand reagierte die Stadt mit einer Neuorganisierung der Zwangsarbeit. Jetzt kam die andere Variante von Arbeit nach dem BSHG - die Jahresverträge - vermehrt ins Spiel. Vereine und Initiativen wurden als Arbeitsstellen einbezogen. Die Stadt hat gehofft, mit dieser etwas besseren Zwangsarbeit diejenigen ruhigzustellen, die am lautesten protestierten, und so das ganze Programm wieder ans Laufen zu kriegen. Teilweise ist ihr das gelungen. (Die Geschichte der Kölner Initiative ist in den Nummern 38 und 39 der »Wildcat« von 1986 nachzulesen).
Grenzen des Zweiten Arbeitsmarktes
Die Proteste gegen staatliche Arbeitsprogramme sind zurückgegangen. Viele Initiativen sind mittlerweile selbst in Abhängigkeit vom Zweiten Arbeitsmarkt geraten. Sie betteln um mehr ABM-Stellen, statt den Arbeitszwang, der in diesen Maßnahmen steckt, zu kritisieren. Und mehr als zwanzig Jahre Massenarbeitslosigkeit zeigen Wirkung. Heute gibt es sicher mehr Leute, die bereit sind, sich in Arbeitsprogramme stecken zu lassen oder ziemlich miese Jobs anzunehmen - weil sie von einem Leben mit wenig Geld und viel Ämterschikanen zermürbt sind, oder weil es angesichts zunehmender Kontrollen schwieriger geworden ist, die magere staatliche Unterstützung durch Schwarzarbeit aufzubessern.
Aber das ist nur die eine Seite. Bei vier Millionen Arbeitslosen (und wesentlich mehr Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen waren oder immer wieder mal sind), ist es nichts Besonderes mehr, und folglich auch keine besondere Schande, staatliche Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Gegen dieses Selbstbewußtsein und 'Anspruchsdenken' wird in letzter Zeit mal wieder enorm viel ideologische Propaganda aufgefahren. Aber trotz aller Hetze gegen 'Drückeberger' hält sich der Arbeitseifer bei vielen Arbeitslosen doch sehr in Grenzen. Von den SozialhilfeempfängerInnen, die 1996 in Köln zwecks Arbeitsberatung vom Sozialamt vorgeladen wurden, ging die Hälfte einfach nicht hin. Die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen funktionieren nur in den seltensten Fällen als Sprungbrett in den Ersten Arbeitsmarkt. Typischer sind ABM-Karrieren: ein langjähriges Wandern zwischen Arbeitslosenunterstützung und staatlich finanzierten Arbeitsmaßnahmen, in denen relativ locker gearbeitet wird.
Seit Mitte der 90er Jahre werden auf staatlicher Seite wieder verstärkt Überlegungen angestellt, mit welchen neuen Modellen Arbeitslose ans Arbeiten gebracht werden können. Das Modell des Zweiten Arbeitsmarktes ist an seine Grenze gestoßen: es können nicht genügend solcher Stellen geschaffen werden, und der Staat finanziert damit unproduktive Arbeit mit geringem Disziplinierungseffekt und ohne Perspektive.
Die neuen Methoden zielen deshalb wieder auf den Ersten Arbeitsmarkt. Arbeitslose sollen nicht mehr teuer in unproduktiven staatlichen Maßnahmen geparkt werden, sondern fitgemacht werden für die Ausbeutung direkt beim Kapitalisten. Der Schwerpunkt verschiebt sich von der Arbeitsbeschaffung zur Arbeitsvermittlung. Statt selbst Stellen zu finanzieren, investiert der Staat in private Arbeitsvermittlungen, die ein Kopfgeld bekommen, wenn sie es schaffen, einen Arbeitslosen in irgendeinem Job der Privatwirtschaft unterzubringen.
Bei diesem Modell geht es nicht nur um das Einsparen von Geldern, sondern auch um einen Angriff auf das vom Staat so gefürchtete 'Anspruchsdenken' und um die Hebung der allgemeinen Arbeitsmoral:
»Wenn ein Langzeitarbeitsloser oder ein älterer Arbeitsloser Arbeit findet, hat dies einen positiven Einfluß auf seine direkte Lebensumgebung. Schließlich wird das Bild, daß 'doch keine Arbeit zu finden ist', auf sehr konkrete Art und Weise durchbrochen. Darüberhinaus kann die Eingliederung einer substantiellen Anzahl schwer vermittelbarer Arbeitssuchender auch einen Beitrag zum Aufbrechen von 'Arbeitslosenkulturen' leisten. Vor allem in sozial benachteiligten Vierteln und Straßen mit hoher Arbeitslosigkeit herrscht nicht selten die Vorstellung vor, daß Arbeit 'nur etwas für Dumme' ist. Die erfolgreiche Vermittlung von Leuten aus solchen Vierteln oder Straßen - und der sichtbare stabilisierende Effekt einer regelmäßigen Arbeit - kann hier eine wichtige Vorbildfunktion erfüllen.« (aus einem Bericht vom Februar 1997 über das erste Maatwerk-Projekt in Hamburg)
Maatwerk - Ausbeutung nach Maß
Der Prototyp der privatisierten Arbeitsvermittlung im Staatsauftrag kommt aus den Niederlanden und nennt sich Maatwerk, Arbeit nach Maß. Die Firma Bureau Maatwerk ist 1991 gegründet worden. Die Initiatoren sind seit 1985 in der Vermittlung schwer vermittelbarer Arbeitsloser tätig und haben dabei den Maatwerk-Ansatz entwickelt. Bureau Maatwerk übernimmt entweder selbst die Arbeitsvermittlung oder aber die Schulung von Arbeitsvermittlern in ihren speziellen Methoden, und ist inzwischen international tätig.
Maatwerk ist eine private Firma. Der Staat bezahlt nicht die Löhne der Vermittler, sondern nur die Leistung, d.h. Kopfprämien für erfolgreiche Vermittlung. Mit der Aufhebung des Vermittlungsmonopols der Arbeitsämter wurde die gesetzliche Grundlage für diese Privatisierung geschaffen. Bundesregierung und Bundesanstalt für Arbeit haben im Dezember 1997 eine Kopfprämie von 2000 Mark für die erfolgreiche Vermittlung eines Alhi-Beziehers in einen sozialversicherungspflichtigen Job vereinbart, der mindestens ein halbes Jahr dauert. Die Vermittlung besonders schwieriger Fälle lassen sie sich 4000 Mark kosten. Denselben Satz kassieren die privaten Arbeitsvermittlungen auch für einen Sozialhilfeempfänger, der es ein Jahr lang auf dem ersten Arbeitsmarkt aushält. Wenn der Arbeitsversuch vorzeitig scheitert, bekommen sie 250 Mark pro Beschäftigungsmonat. Und ebenfalls 250 Mark bezahlt der Staat für einen sogenannten Hilfeplanvorschlag.
Für die Sozialbehörden rechnen sich diese Prämien, denn das Kopfgeld steigert die Effektivität der Arbeitsvermittlung. Die Motivation der Maatwerk-MitarbeiterInnen wird durch die Bezahlung nach Erfolg sichergestellt. Die 'Mir-doch-egal-Haltung' mancher netter Menschen im Arbeitsamt kann bei diesen Leistungskriterien nicht so leicht aufkommen. Im Hamburger Projekt (das seit Anfang 1996 läuft und das erste in der BRD war) wurde z.B. mit Maatwerk ein Vertrag abgeschlossen, in dem sie sich verpflichtet haben, innerhalb von 15 Monaten 300 SozialhilfeempfängerInnen ans Arbeiten zu kriegen.
Die Maatwerk-Methode beruht auf zwei Grundannahmen: erstens gibt es auf dem Arbeitsmarkt versteckte offene Stellen, von denen das Arbeitsamt nie etwas erfährt, und zweitens haben Arbeitslose versteckte Fähigkeiten, die die staatlichen Arbeitsvermittler nie rauskriegen. Der Maatwerk-Trick soll darin bestehen, beide Komponenten maßgerecht zusammenzubringen. Die Politik von Maatwerk betrifft in erster Linie die etwa 33 Prozent der SozialhilfeempfängerInnen zwischen 18 und 65 Jahren, die nach Schätzungen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Die Maatwerk-Vermittler führen mit den Arbeitslosen intensive Gespräche, um eine persönliche Profilanalyse ihrer Arbeitskarriere, ihrer Fähigkeiten und Einschränkungen zu erstellen. Sie 'motivieren' die Arbeitslosen, nach geeigneter Arbeit zu suchen. Aber sie sprechen andererseits auch selbst Unternehmer an, um sie von den Vorzügen der maatwerkvermittelten BewerberInnen zu überzeugen und sich ein Netz potentieller Arbeitgeber aufzubauen.
Für die Unternehmer funktioniert Maatwerk wie ein ausgelagertes (und kostenloses) Personalbüro, das die BewerberInnen vorsortiert und auch nach Arbeitsaufnahme noch bei Problemen interveniert. Denn da die volle Vermittlungsprämie erst nach einem halben bzw. einem Jahr Beschäftigung gezahlt wird, hat Maatwerk großes Interesse daran, daß seine Klienten durchhalten.
Die Maatwerk-Projekte funktionieren als stadtteilbezogene Anbieter und Kontrolleure billiger Arbeitskraft. Sie vermitteln vor allem die neuen DrecksJobs der Dienstleistungsbranchen, wie Pizzafahren, Regaleinräumen im Supermarkt, Putzen usw.
Im Vergleich mit den Arbeitsprogrammen der 70er und 80er Jahre geht der Staat heute zielgenauer und selektiver vor. Es wird versucht, bestimmte Gruppen gezielter zu vermitteln, statt 'Arbeitsunwillige' auf breiter Front mit einheitlichen Maßnahmen abzuschrecken. Die Maatwerk-Modellprojekte werden in 'Problemvierteln' eingerichtet, in denen der Staat Ghettobildung und einen Verfall der Arbeitsmoral befürchtet (siehe obiges Zitat zu Hamburg). In Köln wurden die Stadtteile für die ersten Maatwerk-Projekte nach folgenden Kriterien ausgewählt: Absolute und relative Anzahl von SozialhilfeempfängerInnen, Arbeitslosenquote, Anzahl der psychiatrischen Zwangseinweisungen pro 100.000 Einwohner, und Zahl der Personen in Übergangs- und Wohnheimen.
Jeder soll sein eigener Unternehmer werden...
Das »Maatwerk-Modell« existiert mit Nuancen und unter verschiedenen Namen inzwischen in mehreren Städten bzw. beginnt dort gerade mit seiner unheilvollen Tätigkeit (HH, Potsdam, Köln, Berlin). Der Zwangscharakter, der auch hinter diesen Modellen steckt, kann zunächst recht gut verschleiert werden. In Köln z.B. legt die Sozialbehörde größten Wert darauf, als Träger für die örtlichen »Maatwerk-Büros« (hier schön kölsch unter dem Titel »ProVeedel« - für das Viertel, den Kiez, den Stadtteil - präsentiert) von der Stadt unabhängige, alteingesessene Vereine und Initiativen zu gewinnen, die auch dafür sind, den armen Arbeitslosen endlich aus ihrer Misere zu helfen. Dazu die Kölner Sozialdezernentin Christiansen im Mai 1997:
»Wenn auch nur ansatzweise der Eindruck entsteht, sie [die o.g. Vereine und Initiativen, Anm.d.A.] würden durch ihre Mitwirkung an dem Programm zu einer Art Sozialpolizei, zum verlängerten Arm einer Kontrollbehörde, dann kommen wir hier nicht weiter.« Außerdem will man sich sowieso vorrangig an prinzipiell Arbeitswillige wenden: »Das Programm kann nur erfolgreich sein, wenn wir uns auf die Hilfeempfänger und Hilfeempfängerinnen konzentrieren, die geeignet, und das heißt motiviert sind zur Arbeitsaufnahme. Dieses Programm ist kein Instrument zur Verfolgung von Drückebergern und Schwarzarbeitern. Wer es so mißbraucht, der bringt uns um den gemeinsamen Erfolg, und er handelt auch unwirtschaftlich: In der Zeit, die man aufwenden muß, um einen vermeintlichen oder tatsächlichen Drückeberger zu überführen, kann man zig Motivierte in den Arbeitsmarkt begleiten. Also vergeuden Sie bitte nicht die knappen Personal- und Geldressourcen für die Auseinandersetzung mit den sogenannten schwierigen Kunden.
Bei 'Hilfe zur Arbeit' sind im Augenblick mehrere Tausend, die auf Beschäftigung drängen, die wir aber, da die Ressourcen der Maßnahmen nach § 19.2, erste Alternative begrenzt sind, nicht so schnell mit Stellen bedienen können, wie dies erforderlich wäre.
Die Anwendung des § 25 Abs.1 BSHG (Kürzung der Hilfe) setzt eine sorgfältige Beurteilung objektiver und subjektiver Gründe voraus, und sozialhilferechtlich ist diese Vorschrift vorwiegend zur Motivierung der Hilfeempfänger gedacht. Hierzu wird die Sozialverwaltung noch Anwendungshilfen erarbeiten.«
Daß Arbeitsverweigerer auch künftig keine Ruhe haben sollen, zeigt der letzte Teil vom Zitat. Das Drohmittel Sozialhilfekürzung oder -streichung bleibt bestehen, wird aber in den Hintergrund gerückt. Vordergründig setzen sie auf Freiwillige und versuchen auf diese Weise, den Zwangscharakter ihrer 'Angebote' zu verschleiern.
Es geht ihnen auch darum, insgesamt zu einem Klima beizutragen, in dem Arbeiter und Arbeitslose nicht mehr in den Kategorien von Profit und Ausbeutung, von reich und arm, oder gar von Klassen und Kampf denken, sondern in dem sich jeder wie ein kleiner Unternehmer fühlt: jede soll ihres Glückes Schmiedin sein, jeder trägt das (unternehmerische) Risiko für sein Leben individuell!
Diese Arbeits- und Selbständigkeitsideologie von oben hat durchaus einen Resonanzboden bei einem Teil der Arbeitslosen und ArbeiterInnen selbst. Die jahrzehntelange Arbeitslosigkeit hat dazu beigetragen, daß im Vergleich zu den 70er Jahren auch »von unten« gefordert wird, um (fast) jeden Preis Arbeitsplätze zu schaffen. Bezeichnenderweise wurde das »Bündnis für Arbeit« der CDU-Regierung in seiner Hochphase 1996 auch von Linken wegen seiner Erfolglosigkeit kritisiert! Mithilfe der Arbeitslosigkeit ist also auch mitten unter uns wieder das Prinzip verankert, daß unsere Lebensmittel und unser Einkommen von unserer Arbeit abhängen sollen. Wer nicht arbeitet, soll also auch nicht essen!
Der Erfolg dieser neuen Programme hängt im wesentlichen von zwei Punkten ab: schaffen es Regierung und Kommunen überhaupt, genügend Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor für ihre Schützlinge zu mobilisieren, und lassen sich genügend Arbeitslose widerspruchslos in diese Jobs drücken? Und wie verhält sich die »Stammbelegschaft« zu ihnen, gelingt die beabsichtigte weitere Spaltung oder schaffen wir es, den Kapitalisten die Lust daran zu nehmen, »Maatwerk-Projekte« als vorgelagerte Personalrekrutierung zu benutzen?
Der Angriff gilt uns allen
Die neuen und alten staatlich (kommunal) betriebenen Arbeitsprogramme wirken sich auf die Bedingungen der Klasse insgesamt aus: Staatliche Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen waren in den 80er Jahren Vorreiterinnen für verschlechterte Arbeitsbedingungen (z.B. wurden über ABM zum erstenmal Befristungen in Arbeitsverträgen üblich, was sich später auf gesetzlicher Ebene niederschlug, es wurden Löhne zu 90 Prozent und weniger vom Tarif gezahlt, später vereinbarte z.B. in der Chemieindustrie die zuständige Gewerkschaft Einstiegslöhne mit 90 Prozent vom untersten Tariflohn). Aktuell bedienen Maatwerk und Konsorten vor allem den Sektor des Arbeitsmarktes, in dem es um schlechtbezahlte, anstrengende und prekäre Jobs geht.
Die Maßnahmen betreffen auch diejenigen, die heute zu den durchschnittlich üblichen Bedingungen arbeiten. Denn je mehr Arbeitslose in schlechtere Jobs zu geringeren Löhnen gezwungen werden können, desto stärker geraten auch die Bedingungen der übrigen Beschäftigten unter Druck. Ganz konkret bekommen das die Beschäftigten einiger kommunaler Sektoren zu spüren: ihre Forderungen und Ansprüche können viel eher zurückgewiesen werden, wenn die Kommunen es schaffen, die Arbeiten teilweise von zwangsverpflichteten SozialhilfeempfängerInnen erledigen zu lassen. Im großen Supermarkt, der kleinen Klitsche oder auch im Großbetrieb werden schon kleinere Auseinandersetzungen viel komplizierter, wenn neben dem »Stammpersonal« immer mehr LeiharbeiterInnen, Maatwerk-Geschädigte, gratis arbeitende Praktikanten etc stehen. Andererseits bietet eine solche neue Zusammensetzung der Beschäftigten auch mehr Möglichkeiten, den jeweiligen Laden zum Kochen zu bringen, denn die Unzufriedenheit mit der Arbeit wird nicht lange unter dem Deckel zu halten sein.
Wir werden uns also nicht nur damit auseinandersetzen, wie wir uns konkret gegen die »Maatwerk«-Schweinereien verhalten. Diese sind nur ein Baustein in der allgemeinen Intensivierung von Arbeitszwang und Ausbeutung sowie in der Förderung des Niedriglohnsektors; dazu gehören ebenfalls die Diskussionen um Kombilöhne, die »Neuregelung« der 630er-Jobs, die Ausweitung neuer Dienstleistungen und die staatliche Förderung von Leiharbeit (durch Verbesserung der gesetzlichen Bedingungen für die Verleihfirmen).
Uns muß es deshalb darum gehen, die ganze Mauer niederzureißen. Die praktische Kritik an den neuen kommunalen Beschäftigungsprogrammen könnte ein Ansatzpunkt dafür sein. Wir wollen also nicht speziell die »Workfare-Jobs« angehen, sondern die gesamte Bandbreite der Ausbeutung in den jeweiligen Betrieben.
j./n., köln, Januar 1999