gegen.entwürfe
Es gibt eine linke Tradition, aus der Analyse der ökonomischen Bedingungen und den Strategien der Herrschenden abzuleiten, was »die Klasse« zu tun habe. So was hat den Vorteil, dass solche Linken immer genau angeben können, was ihrer Ansicht nach zu tun sei – und für sich selber auch immer gleich ein bevorzugtes Plätzchen in den zukünftigen Schlachten reserviert haben. Es hat aber den Nachteil, dass ihre Traktate nur so wimmeln von Wörtern wie »sollen« – und überhaupt schlecht geschrieben und extrem unspannend zu lesen sind. Subversive Impulse »von unten« (um im Bild zu bleiben) sucht man in solchen Abhandlungen auch vergebens – zum Glück, denn reale Menschen lassen sich in einem solchen Schema nicht einfangen.
Es gibt andere linksradikale Traditionen, die wissen, dass Pläne von oben nie 1:1 aufgehen, »Prekarisierung« nicht mit Verelendung gleichzusetzen ist, die Träume der Rationalisierer nicht mit der betrieblichen Wirklichkeit usw.. Sie versuchen, die proletarischen Erfahrungen zu verstehen, machen Interviews, lassen die Leute ihr Leben, ihre Wünsche, ihre Erfahrungen erzählen…
»… sind sie Kommunist?«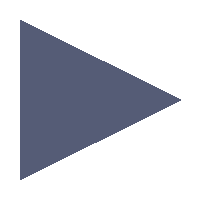
»Je weniger Geld man hat, umso mehr Zeit braucht man …«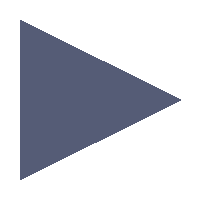
»… dass du irgendwo ganz oben auf einer Telefonliste stehst …«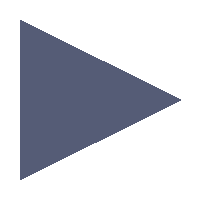
»Werzeugmacher ist Scheiße…«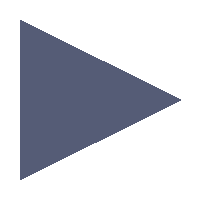
Während der Wochen, in denen der massive Angriff zur weiteren Ausdehnung der Arbeitszeiten anlief, haben wir Leute befragt, die irgendwann entschieden haben, sich dem kapitalistischen Arbeits- und Konsumzwang nicht voll auszuliefern, sondern ihm Grenzen zu setzen. Es sind individuelle Versuche, gewiss, aber bis in die 80er Jahre hinein waren solche Verhaltensweisen Teil einer sozialen Bewegung und hatten im Gesamtproletariat das Flair derer, »die wissen, wie man‘s macht!«, so ‘n bißchen bewundert, weil sie was »gewagt« hatten. Heute ist der Wunsch nach kürzeren Arbeitszeiten gesellschaftlich viel breiter (Teilzeitarbeit), gleichzeitig wächst der Druck »von oben« ungeheuer an, immer länger zu arbeiten. Die gewerkschaftliche Strategie, Arbeitszeitverkürzung im Deal mit Flexibilisierung einzuführen, hat sich als das offene Scheunentor erwiesen, um die Verfügung über die eigene Zeit immer mehr einzuschränken.
Wir haben Leute interviewt, die ihr Arbeitsleben bewusst anders angehen. Die sich von zwei bis drei Monaten Lohnarbeit im Jahr ernähren, die mit allerbesten Qualifikationen als Saisonarbeiter jobben, die sich in ihrem politischen und sozialen Engagement verwirklichen und keine falsche Bestätigung im »Beruf« suchen, denen die Verfügung über die eigene Zeit wichtiger ist als ein hohes Einkommen.
Wir wollten die Interview-Reihe »Proletarische Lebensentwürfe« nennen. Aber wir haben gemerkt, dass es gerade daran mangelt: an Konzepten, die man offensiv und nach außen vertreten könnte. Die beiden Älteren haben sich in ihrer Jugend bewusst nicht an Karriere orientiert, sondern das gemacht, was sie selber wollten. Mit der Zeit wurde daraus eher ein beharrliches und erfindungsreiches Sich-Durchwursteln, ein Sich-Behaupten durch die Widrigkeiten der Umstände hindurch. Hier war ein überraschendes Ergebnis, dass sich die Schere zwischen einem qualifizierten Fabrikarbeiter und einem Jobber über die Jahrzehnte nicht geöffnet hat – noch nicht? Die Jüngeren denken gar nicht viel über »Konzepte« nach, sie sind auf vielen Gebieten engagiert und haben gar nicht die Zeit, sich einen Kopf ums Geldverdienen zu machen.
Wenig arbeiten und gut leben – wo kommt das Geld her?
In den 70er Jahren wussten viele ziemlich genau, wie sie nicht leben wollten: wie die Eltern, das Leben lang malochen, an den Betrieb gefesselt, der den gesamten Alltag bestimmt, bis man kurz nach der Verrentung zusammenbricht. Für viele, die das Gymnasium (fast oder ganz) durchlaufen hatten (damals waren das noch nicht so viele), sogar auf die Uni gingen, hieß das auch: keine Karriere machen, niemals Vorgesetzter sein, niemals andere Leute zur Arbeit antreiben. Einige entschieden sich, statt dem Professor in den Arsch zu kriechen, in den Betrieb zu gehen, wo das Leben tobt, und mit anderen ArbeiterInnen auf gleicher Ebene zusammenzuarbeiten. Es war eine Erfahrung, die ihren weiteren Lebensweg bestimmte und sie gegen Korruptionsversuche immunisierte.
Bis vor ein paar Jahren wurde noch offen diskutiert: ’selbständig‘, kann man das überhaupt machen? ist man da nicht schon Unternehmer, auf der anderen Seite, fängt an, anders zu denken? Heute sind viele formell selbständig, in Wirklichkeit aber Proletarier, die nicht viel mehr besitzen als ihr Werkzeug oder ihren Computer und völlig abhängig von ihrem Auftraggeber sind. Trotzdem verändert sich das Denken, weil man auf einmal anders zu rechnen beginnt, Sachen von der Steuer absetzen kann, usw. usf. Absprachen, welche Jobs man macht und welche nicht, unter welchem Lohn man keinen Auftrag annimmt, funktionieren schlecht, wenn die Auftragslage schlecht ist. Dennoch halten sich bei Jüngeren wie Älteren bestimmte Vorstellungen, was man nicht tut: als Wachmann arbeiten, zum Sklavenhändler geht man nur, wenn gar nix anderes mehr geht usw.. Die Grenze liegt ganz klar dort, wo jemand andere für sich arbeiten lässt und sich einen Teil dessen aneignet, was sie erarbeiten. Das nicht zu tun, ist heute längst nicht mehr selbstverständlich, weder in der »linken Szene« noch innerhalb der Arbeiterklasse.
Die Messebauer und die Metallbauerin versuchen, sich als Kollektive die Möglichkeit zu erhalten, wenig zu arbeiten, um die Zeit für politische und andere Projekte frei zu haben. Dazu gehört auch, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn mal kein Auftrag da ist, sich Fähigkeiten beizubringen und zu versuchen, mit anderen Arbeitern eine gemeinsame Basis herzustellen, damit man sich nicht kaputt konkurriert.
Heute ist die herrschende Parole: Wir sollen für das gleiche Geld länger arbeiten. Es soll wieder normal sein, jeden Tag acht oder auch zehn Stunden zu malochen. Vorbei die Träumereien über die »Zeitautonomie«: Um uns dahin zu bringen, braucht es auch Elend, braucht es die Drohung mit der Verarmung.
Aber wer gelernt hat, mit 300 Euro im Monat auszukommen oder schon einige harte Jobs hinter sich hat, und vor allem, wer gelernt hat, sich mit anderen zu organisieren: wovor soll die Angst haben?
Aus einem »Gespräch freier und festangestellter JournalistInnen«, Frankfurter Rundschau, 7.8.2004.
»Ich bin Mitte 40 und habe mich bisher nicht um die Riester-Rente und so einen Kram gekümmert. Was das individuelle Verhalten angeht, bewege ich mich immer noch wie ein 20-Jähriger. Ich lebe verschwenderisch, habe kein Sparbuch und erwarte kein Erbe. Alle sozialpolitische Einsicht, über die ich verfüge, hat sich in lebenspraktischer Hinsicht noch nicht geäußert.«
»Ich versuche ständig, Brücken zu schlagen, eine nach der anderen, immer wieder über den gleichen Fluss, aber ich habe das Gefühl, an keinem Ufer bleiben zu können. Das geht in meiner Generation vielen so. Die Leute fangen an zu promovieren, schulen um auf Lehramt, machen Aufbaustudiengänge oder Praktika. Wir qualifizieren uns zu Tode. Man entwickelt sich auch, aber man tritt noch mehr auf der Stelle; man ist die ganze Zeit in Bewegung, aber man kommt nicht an.«
»Ich habe keinen großen Lebensentwurf mehr, sondern denke mittlerweile extrem kurzfristig. Es überfordert mich, über den nächsten Schritt hinauszudenken, mir Gedanken zu machen, was ich in die nächste Bewerbung schreibe und wie ich den nächsten Umzug plane.«
»Ich betrachte es dagegen als Vorteil, nicht fest angestellt zu sein. Mann kann mich also auch nicht kündigen. Irgendwie hänge ich immer auch der geheimen Hoffnung an, dass die Arbeit einmal aufhört. Ich habe ein inneres Parallelleben, das sagt: Ich bin keine arbeitende Frau. Ich lebe also mehr von einer Ausstiegshoffnung als mit einer Abstiegsangst.«
»Ich war kürzlich auf dem Arbeitsamt, um mich zu erkundigen, was passiert, wenn ich meinen Job verliere. Da stellte man mir in Aussicht, Sozialhilfe zu beantragen. Für diesen Fall müsse ich aber meine Bedürftigkeit nachweisen. Danach hatte ich das erste Mal richtig Abstiegsangst. Das steht in keinem Verhältnis zu dem, was ich anzubieten habe: ein gutes Abitur, verschiedene Fähigkeiten, zwei Berufsausbildungen, immer hart am Ball gewesen. Bedürftigkeit nachweisen passt nicht in mein Weltbild.«
aus: Wildcat 71, Herbst 2004