Schafft
erste,zweite, dritte Arbeitsmärkte …ab!
Mit Hartz IV sollen massenhaft Leute in »Ein-Euro-Jobs« reingedrückt werden. Seit Mitte der 70er Jahre gibt es Erfahrungen mit der Einführung und Durchsetzung von Zwangsarbeit – und mal mehr, mal weniger erfolgreiche Aktivitäten, dem etwas entgegen zusetzen. Wir dokumentieren hier in Auszügen aus der Wildcat 38 und 39 von 1986 Erfahrungen und Aktionen in Köln und Witten. In den 90er Jahren ist es genau so weitergegangen, wie es am Ende der Artikel vermutet wurde: Nach der Krise 1992/93 hat die Zahl der SozialhilfeempfängerInnen schneller als die Zahl der Arbeitslosen zugenommen. Darauf haben Staat und Kommunen mit immer neuen Programmen reagiert: »Jugendprogramme«, mit denen klargemacht werden sollte, dass es kein Leben ohne Arbeit gibt; die Vermittlung über private Sklavenhändler, die dafür Kopfprämien kassieren; »Kommunale Leitstellen für Arbeit«, die SozialhilfeempfängerInnen an städtische Betriebe oder »gemeinnützige« Einrichtungen vermitteln. Viele dieser Jobs werden heute zu Ein-Euro-Jobs umgewandelt. Offene Verweigerung dieser Jobs hat es nur selten gegeben – 20 Jahre Massenarbeitslosigkeit scheinen Wirkung zu zeigen. Hinzu kommt, dass viele Initiativen, die in den 80er Jahren die Bedeutung und Funktion solcher Arbeitsprogramme zumindest noch diskutiert haben, inzwischen noch mehr von den Geldern abhängig sind, die über solche Programme verteilt werden.
Es muss sich erst noch zeigen, wie viele dieser Stellen es tatsächlich geben wird. Für Aufregung haben die Berichte von »Ein-Euro-Jobbern« bei der »Hamburger Arbeit« gesorgt – wobei weniger die entwürdigenden Bedingungen überraschen, als der Umstand, dass sich das so viele bieten lassen.
Aus den Artikeln können sicher keine schnellen Antworten auf die Frage gezogen werden, was gegen die »Ein-Euro-Jobs« getan werden kann. Aber einige der politischen Fragen und praktischen Probleme stellen sich heute wieder: Öffentlichkeitsarbeit und/oder Versuche, in den Jobs selber gegen die Arbeit aktiv werden? Was ist mit den »linken Projekten«? Seit der Einführung von AB-Maßnahmen in den 70er Jahren finanzierten sich immer mehr Projekte über staatlich subventionierte (Zwangs-)Arbeitsprogramme – kann das überhaupt noch offen diskutiert werden? Bringt die breite Einführung der »Ein-Euro-Jobs« neue Möglichkeiten von Gemeinsamkeit und Solidarität!?
Die vollständigen Artikel über die Erfahrungen in Köln findet ihr auf unserer Webseite:
Zwei Jahre Erfahrungen mit der kommunalen Zwangsarbeit in Köln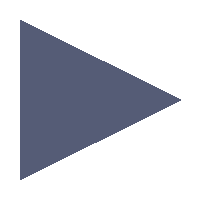
Schafft eins, zwei, drei … viele Arbeitsmärkte …ab!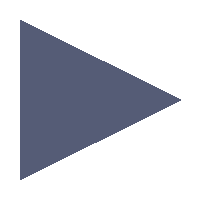
Die Situation in den 90er Jahren diskutiert der Artikel
Stadtluft macht Arbeit – Kommunaler Arbeitszwang als Baustein des Niedriglohnsektors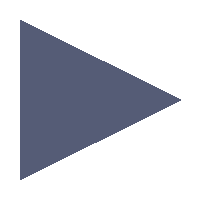
Mehr zur Hamburger Arbeit findet ihr unter www.steinbergrecherche.com
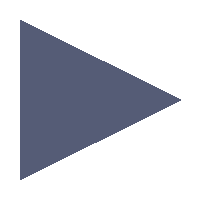
1984 – die 1,50 DM-Zwangsarbeit wird ausgehöhlt
Im Mai ’84 schlossen wir uns, eine Handvoll Leute aus dem autonomen und Hausbesetzerspektrum in Köln, zur Initiative Weg mit der Zwangsarbeit! zusammen. Seitdem die Sozialämter in vielen Städten der BRD damit angefangen haben, AsylantInnen in Zwangsarbeit einzuweisen, war das Thema ein Dauerbrenner. Es lag also nahe, zunächst an dieser Form von Zwangsarbeit anzusetzen, Unruhe auf Ämtern und Einsatzstellen zu organisieren und Leute aus der Zwangsarbeit rauszuholen, um dann Beispiele einer erfolgreichen Verweigerung propagieren zu können. Damit griffen wir nur die bereits entwickelten Verhaltensweisen der Sozi-EmpfängerInnen auf. Wie wir aus internen Statistiken des Sozialamtes erfahren hatten, war die individuelle Verweigerung – allerdings auch mit der häufigen Streichung der Sozialhilfe verbunden – weit verbreitet. (…) Es kam für uns also darauf an, die Streichung der Sozialhilfe bei Arbeitsverweigerung zu verhindern.
Unruhe auf den Ämtern – und Verrechtlichung als Antwort
Da es keine Basis für eine massenhafte politische Bewegung unter den Sozialhilfeempfängern gab, konnten wir zunächst nur versuchen, die rechtlichen Regelungen zu benutzen. Wir propagierten auf den ersten Flugblättern solche Möglichkeiten wie schriftliche Bescheide zu verlangen, Widerspruch einzulegen, bis hin zur Klage vorm Verwaltungsgericht, um die Einweisung in Zwangsarbeit zumindest hinauszuzögern. Bei den Leuten, die das mit uns zusammen machten, war diese Praxis sehr effektiv.
Wenn wir mit Leuten, die eingewiesen werden sollten, zum Amt turnten, gingen wir immer zu mehreren rein, machten die Auseinandersetzung auch für andere im Warteraum öffentlich. Der Versuch der Amtsärsche, uns daran mit Bullengewalt zu hindern, war auch nicht sehr produktiv für sie, da uns solche Rangeleien nur noch mehr Publizität einbrachten.
Intervention von außen oder Selbstorganisation?
Uns ging es in erster Linie darum, daß sich die Zwangsarbeiterinnen selbst gegen die Arbeit zusammenschließen, daß sie es schaffen, durch ihre kollektive Aktion – »Streik!« – die Arbeit zu kippen. Über die Ämter ließ sich das aber nicht organisieren, da wir ständig auf neue Leute stießen, es immer bei einzelnen Aktionen blieb und die Leute nach erfolgreicher Freistellung von der Arbeit das Interesse an der Initiative verloren.
Um innerhalb der Arbeit den Widerstand zu entwickeln, versuchten wir mit Leuten, die eingewiesen werden sollten, andere Aktionen zu machen: erstmal nichts gegen die Einweisung unternehmen, die Arbeit antreten, um mit den anderen Arbeitern in Kontakt zu kommen und dort den Wirbel veranstalten. Dort wo wir größere Aktionen auf den Arbeitsstellen machten, wie eine Demo auf dem Friedhof, war es der stärkste Druck auf das Sozialamt. Die Leiter der Einsatzstelle bangten um die Arbeitsbereitschaft einer ganzen Kolonne, schickten die Leute sofort weg, und die Kritik wurde an eine größere Öffentlichkeit getragen.
Es ist uns aber nie gelungen, ein kollektives Verhalten der Leute auf den Arbeitsstellen zu erreichen, was durchaus auch an der Durchmischung der Kolonnen und der extremen Fluktuation lag: fest eingestellte städtische Arbeiter, ABM-Kräfte, deutsche Soziempfänger und Asylanten. Fast alle Leute, mit denen wir Aktionen machten, kannten wir über die besetzten Häuser, den SSK oder die politische Szene.
Eine Wittener Gruppe hatte Mitte der 80er Jahre versucht, die Zwangsarbeit »von Innen« auszuhebeln –
im Folgenden könnt Ihr einen Ausschnitt aus Erwins Erfahrungen nachlesen.
»Für einige von uns stellte sich an diesem Punkt erneut die Frage, wie wir weg von den individuellen Formen der Verweigerung hin zu kollektiven Schritten der Arbeitsverweigerung kommen könnten. Da wir den Zeitpunkt als günstig einschätzten, entschlossen wir uns im Frühjahr ’85, die Arbeit anzunehmen, mit der Vorstellung, langfristig an den Arbeitsorten Widerstand entwickeln zu können. (…)
Einen Monat später bekam Erwin endlich einen Arbeitsplatz zugeteilt. Als erstes erklärte der etwas unruhig wirkende Vorarbeiter (inzwischen waren sechs Zwangsarbeiter, darunter drei Tamilen, mit einer halben Stunde Verspätung erschienen, nur Erwin war pünktlich), dass die 7-Stunden-Regelung in seinem Arbeitsbereich keine Geltung hätte, da sie nicht zu realisieren wäre, bei ihm arbeiten alle gleich, und die ZwangsarbeitInnen bekämen dann einen Tag frei – wie sich später rausstellte bei schlechtem Wetter wenn sie eh nicht benötigt wurden. In der anschliessenden, heftig geführten Diskussion wurde schnell klar, dass bei dieser Arbeitsstelle nur eine einheitliche Zeitregelung durchführbar war, denn der Vorarbeiter brachte die Arbeiter morgens in kleinen Gruppen zu ihren Arbeitsorten und holte sie dann acht Stunden später wieder ab. Hätte er nach sieben Stunden rumfahren müssen, um die Zwangsarbeiter einzusammeln, wäre das organisatorisch nicht zu bewältigen gewesen. Angesichts dieser Tatsache bestanden die Anwesenden erst recht auf dem 7-Stundentag. Auf die Verarsche mit dem freien Tag wollte sich keiner einlassen. (Erwins Herz lachte, der Vorarbeiter tobte.) Da keiner die Arbeit aufnehmen wollte, bevor die Sache geklärt war, und die festen Arbeiter sowieso keine Eile hatten, an die Arbeit gebracht zu werden, blieb dem Vorarbeiter keine andere Wahl. Für die mit uns eingeteilten Festangestellten hieß das konkret Arbeitszeitverkürzung auf sieben Stunden bei vollem Lohnausgleich. (…)«
Wildcat 39/1986 — den gesamten Text findet ihr [hier].
»Neue Armut« – die Spaltungslinie der Armutsverwalter
Während sich zig Kölner Gruppen um Verkehrsberuhigung und Fahrradfreundlichkeit sorgten, lernten wir Asylanten kennen, die als Zwangsarbeiter die Radwege rot anstreichen mussten. Und einige Initiativen ließen bereits Sozialhilfeempfänger die Zwangsarbeit bei ihnen ableisten. Hier machte das Sozialamt die ersten Versuche, alternative Gruppen in die Organisation der Zwangsarbeit miteinzubeziehen, woran es mit dem neuen Programm 1985 anknüpfen konnte. Zum zweiten mussten wir uns mit Gruppen aus dem Spektrum Kirche, Gewerkschaften, Grüne, DKP auseinandersetzen, die mit ihrer Kritik an der Zwangsarbeit das öffentliche Interesse an diesem Thema bestimmten. Dieser Kritik ging es darum, die Ablehnung der Zwangsarbeit mit der Forderung nach »besseren« Arbeitsgelegenheiten zu verbinden. Mit dem Begriff Neue Armut, der zu dieser Zeit aufkam, wurde die linksliberale Empörung über die Entgarantierung ausgedrückt – aber gerade nicht als Kritik der im Kapitalismus systematischen Armut.
Die Spaltungslinie in der späteren Umstellung der generellen Pflichtarbeit für 1,50 DM auf ein differenziertes Arbeitsprogramm war hier schon angelegt: für diejenigen, die sich auf Grund ihrer Ausbildung und der ihnen im System versprochenen sozialen Stellung gegen die Zwangsarbeit empörten, wurden verbesserte und für sie attraktive Arbeitsgelegenheiten geschaffen, während der Druck auf die »alte« Armut nach Abflauen der öffentlichen Kritik in einem neuen Anlauf gesteigert werden konnte.
Die Große Koalition der Arbeitsbeschaffer
Als wir für Anfang November 1984 zu einem Go–In beim Sozialdezernenten mobilisierten, kamen etwa 70 Leute aus einem breiten Spektrum von Selbsthilfegruppen über DKP bis hin zu den Autonomen. Die 1,50 DM-Zwangsarbeit war gerade deswegen angreifbar geworden, weil sie unterschiedslos allen Sozialhilfeempfängern aufgedrückt wird – dem nicht sesshaften Berber, wie dem arbeitslosen Diplompädagogen. Um die Arbeitsstellen im selben Umfang ausweiten zu können, wie die Zahl der Sozialhilfeempfänger – gerade der jungen – stieg, und um deren Arbeitseinsatz auch produktiv gestalten zu können, war ein neues Instrumentarium erforderlich. Eine neue Gestaltung des Arbeitszwangs für Sozialhilfeempfänger wird gebraucht, um den Ansätzen von Widerstand das Wasser abgraben und um den Arbeitszwang weiter ausweiten zu können: »Aus diesem Grunde muss die Hilfe zur Arbeit in Köln neu geordnet werden. Sozialhilfeempfänger sollen befristete versicherungspflichtige Arbeitsverträge bekommen. Neben den von der Verwaltung bereits eingeleiteten Initiativen sollen mit weiteren Maßnahmen zunächst bis zu 500 entsprechende Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Arbeitsverträge sollen so offen konzipiert werden, dass ein Einbeziehen in einen zu schaffenden zweiten Arbeitsmarkt möglich ist.« [SPD-Antrag im Sozialausschuss Köln, 1984]
Die Spaltung funktioniert politisch
Nach dem Beschluss des neuen Programms war uns klar, dass es nun nicht mehr so einfach sein würde, Aktionen gegen die Zwangsarbeit zu machen, bzw. damit etwas auszulösen. Die Spaltungslinien waren bereits 1984 vorgezeichnet. Selbsthilfegruppen oder soziale Projekte würden sich auf die Stellen stürzen, arbeitslose Sozialarbeiter sich um die Stellen rangeln, während die klassischen Sozialhilfeempfänger zu den Arbeiten im Grünflächenbereich gezwungen würden, ohne dafür wesentlich mehr Geld zu bekommen.
Im Januar 1985 machten wir eine Veranstaltung, zu der sowohl einige Leute aus Projekten, wie ein Teil der autonomen Szene erschienen. Wir gaben zunächst einen Rückblick auf die Entwicklung der Zwangsarbeit in der Weimarer Republik zum Reichsarbeitsdienst. Wichtig im Vergleich zu heute war zum einen das Bestreben, die Zwangsarbeit produktiv zu machen, auch in der Industrie zu etablieren; zum anderen die Mitwirkung von Teilen der damaligen Alternativbewegung, z.B. der Bündischen Jugend, die im Rahmen des Freiwilligen Arbeitsdienstes Arbeitslager im Grünen organisierte, um »neue Lebensformen« mit Arbeit »für das gesellschaftliche Ganze« zu verbinden. Genauso beteiligten sich SPD und ADGB durch einen eigenen, 1932 gegründeten Trägerverein am FAD. Zur aktuellen Situation stellten wir den Zusammenhang der neuen Arbeitsprogramme für Sozialhilfeempfänger mit der gesamten Prekarisierung dar. Die Formen des staatlichen Arbeitszwangs flankieren die auf dem »freien« Arbeitsmarkt durchgesetzten Veränderungen des normalen kapitalistischen Arbeitszwangs. Wir schlugen daher vor, die Aktionen und den praktischen Widerstand auf andere Formen des staatlichen wie des ’freien’ Arbeitszwangs auszudehnen: ABM, Jugendförderungsprogramme, wie sie in Köln bei Ford und KHD durchgeführt werden, Sklavenhändler und Drückerjobs. Die Diskussion, hauptsächlich von den Projektvertretern bestimmt, blieb von Anfang an bei der Frage hängen, ob das neue Arbeitsprogramm der Stadt nicht doch sein Gutes hätte; dass sie als Projekte auf ABM angewiesen sind usw..
Die neuen (proletarischen) Kolonnen im Grünflächenbereich
Die politische Spaltung, die mit den neuen Verträgen einsetzte, ist in der Struktur der Sozialhilfeempfänger angelegt. Klar wurde uns daran nochmal, dass es »den Sozialhilfeempfänger« als soziale Figur nicht gibt, daher auch alle Initiativen, die von dem Sozialhilfeempfänger oder dem Erwerbslosen ausgehen, die tatsächliche Zusammensetzung der Klasse ignorieren, die sozialen Subjekte entlang der jeweiligen Einkommensquelle definieren. (…) An den einzelnen Auseinandersetzungspunkten drückte sich bei den Arbeitern die bleibende Wut auch auf eine neue Zwangsarbeit aus. Bei Abschluss der Verträge wurden sie massiv auf die Möglichkeit der Sozialhilfestreichungen hingewiesen; was auch nötig war, da viele von ihnen durch die 40 Stunden Arbeit kaum mehr Geld als vorher hatten.
Gebrauch des neuen Programms von unten und Gegenmaßnahmen
Die einzige Möglichkeit für ArbeiterInnen, das neue Zwangsarbeitsprogramm zu benutzen, lag in dessen verringerter Abschreckungswirkung. Die Leute wurden natürlich vom Sozialamt nicht von der Neuorganisation der Zwangsarbeit informiert, aber langsam sprach es sich herum, dass die 1,50 DM-Arbeit zumindest den sesshaften Sozialhilfeempfängern nicht mehr aufgebrummt würde. Der neue Arbeitszwang lässt sich leichter umgehen und der Gebrauch der Sozialhilfe weitet sich auch deshalb weiter aus. Mit verschiedenen, zum Teil improvisierten Maßnahmen versuchen die Sozialämter, dem zu begegnen. Einzelne Sachbearbeiter drohen den Antragstellern weiterhin mit der 1,50 DM Zwangsarbeit. Im Unterschied zu 1984 wurde die 1,50 DM-Zwangsarbeit aber nur sehr selektiv bei einigen der harten Arbeitsverweigerern angewandt, so daß auch keine Unterstützung der übrigen, mit Verträgen arbeitenden SozialhilfeempfängerInnen zu erwarten war.
Schon bei der Einführung der Verträge lief in der SPD die Diskussion über ein »Gesamtprogramm Zweiter Arbeitsmarkt«… Favorisiert wird offensichtlich eine eigenständige »Beschäftigungs GmbH«, die Verträge mit Sozialhilfeempfängern oder ABM-Kräften macht und diese an andere Firmen oder Städtische Stellen ausleiht. Organisatorisch wird von der SPD das Modell eines kommunalen Sklavenhändlers, der alle Bereiche des Zweiten Arbeitsmarktes verwaltet, bevorzugt.
wildcat 38/39 1986
aus: Wildcat 72, Januar 2005